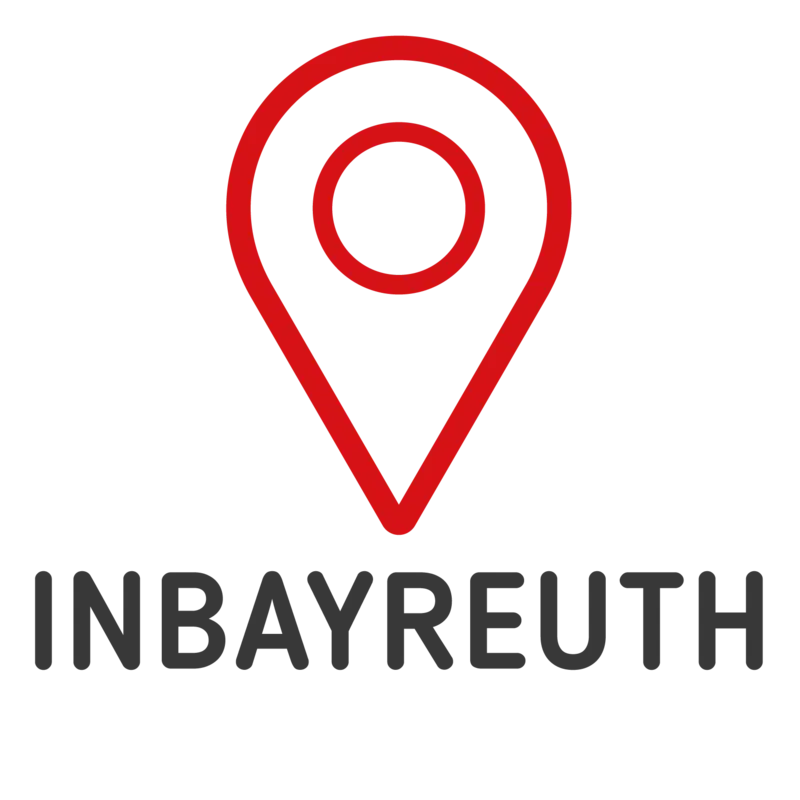Tipps vom Fachanwalt für Erbrecht: Die Nießbrauch-Falle bei der Vermögensnachfolge
Eine wohlüberlegte Vermögensübertragung zu Lebzeiten ist ein klassisches Instrument der Nachfolgeplanung. Häufiges Ziel ist es, den Pflichtteil bestimmter gesetzlicher Erben zu reduzieren. Viele verlassen sich dabei auf die zehnjährige Frist des Gesetzgebers. Jedoch kann eine einzige Klausel im Übergabevertrag – der Nießbrauchvorbehalt – diese Strategie unterlaufen und zu erheblichen finanziellen Konsequenzen führen. Ein Sachverhalt aus der Praxis illustriert diese oft übersehene Komplexität.
Der Sachverhalt: Das übertragene Anwesen
Ein Vater beabsichtigt, sein Erbe zu ordnen. Das Familienanwesen soll auf seine Tochter übergehen. Sein Sohn, zu dem der Kontakt abgebrochen ist, soll von der Nachfolge ausgeschlossen werden. Problem ist der Pflichtteil des Sohnes, also der gesetzliche Anspruch auf einen Anteil am Familienvermögen. Um den gesetzlichen Pflichtteilsergänzungsanspruch des Sohnes nach Möglichkeit auszuschließen, überträgt er das Anwesen per Schenkung auf die Tochter. Zur eigenen Absicherung behält er sich jedoch ein lebenslanges, umfassendes Nießbrauchsrecht vor. Diese Klausel gestattet ihm, die Immobilie weiterhin unentgeltlich zu bewohnen oder, nach seinem Belieben, zu vermieten und die Erträge für sich zu vereinnahmen.
Zwei Jahrzehnte später verstirbt der Vater. Der enterbte Sohn tritt an seine Schwester heran und macht seinen Pflichtteilsergänzungsanspruch am Wert des Anwesens geltend.
Die juristische Problematik: Der Beginn der Zehnjahresfrist
Die Tochter befindet sich in einer nachvollziehbaren, wenngleich trügerischen Sicherheit. Sie verweist auf die gesetzliche Regelung, wonach Schenkungen für die Pflichtteilsberechnung nach Ablauf von zehn Jahren nicht mehr berücksichtigt werden.
Ihre Argumentation: Die Übertragung des Eigentums liege zwanzig Jahre zurück, die Frist sei somit verstrichen, und ein Anspruch des Bruders bestehe nicht. Die entscheidende Frage lautet jedoch: Wurde das Anwesen im juristischen Sinne tatsächlich unentgeltlich „geleistet“, wenn der Vater aufgrund seines umfassenden Nutzungsrechts die Immobilie nach der Übertragung auf die Tochter unverändert weiter nutzen konnte wie vorher?
Die höchstrichterliche Lösung: Das Prinzip des „spürbaren Opfers“
Der Bundesgerichtshof (BGH) beantwortet diese Frage in ständiger Rechtsprechung eindeutig und im Sinne des Sohnes.
Die Zehnjahresfrist, so der BGH, beginnt nicht zu laufen, solange sich der Schenker ein umfassendes Nießbrauchsrecht vorbehält.
Die richterliche Begründung ist von ökonomischer Logik geprägt: Eine Schenkung gilt erst dann als vollzogen, wenn der Schenker ein „spürbares Opfer“ erbringt und den „Genuss“ des Vermögenswertes endgültig aufgibt. Da der Vater das Anwesen wirtschaftlich weiterhin wie ein Eigentümer nutzte, hat er es aus seinem Vermögen nie wirklich ausgegliedert. Die Schenkung war somit nicht im Sinne des Gesetzes „geleistet“.
Folglich wird die Immobilie für die Berechnung des Pflichtteilsanspruchs so behandelt, als hätte sie bis zum Erbfall im Vermögen des Vaters gestanden. Die Tochter ist zur Auszahlung des Anteils an ihren Bruder verpflichtet.
Der BGH kommt dem Wunsch des Vaters dennoch entgegen: Wenn die Immobilie im Wert gestiegen ist, was praktisch immer der Fall ist, dann ist der Wert der Immobilie zum damaligen Zeitpunkt der Schenkung abzüglich des kapitalisierten Wertes des Nießbrauchsrechts maßgeblich, und nicht der Wert im Zeitpunkt des Erbfalls.
Empfehlung für die Praxis: Wer schenkt, muss den Genuss aufgeben Dieser Fall beleuchtet eine der fundamentalsten Weichenstellungen bei der vorweggenommenen Erbfolge. Wer den Pflichtteil durch eine Schenkung wirksam reduzieren möchte, muss den wirtschaftlichen Genuss des übertragenen Vermögenswertes aufgeben. Ein umfassender Nießbrauchvorbehalt ist in dieser Hinsicht kontraproduktiv, da er den Beginn der Frist verhindert.
Anders kann der Fall bei einem bloßen Wohnungsrecht liegen, insbesondere wenn sich dieses nur auf Teile der Immobilie erstreckt. Hier stellt der BGH maßgeblich darauf ab, ob der Schenker der „Herr im Haus“ bleibt oder die wirtschaftliche Kontrolle weitgehend abgibt. Eine exakte prozentuale Grenze, etwa bezogen auf die Wohnfläche, hat der BGH bislang nicht definiert; es verbleibt bei einer Beurteilung der Umstände des Einzelfalls.
Bestens beraten.
www.zeitler.law
Fachanwalt für Erbrecht & Familienrecht
Karl-Marx-Straße 7 - 95444 Bayreuth
Telefon: 0921/15 13 79-7