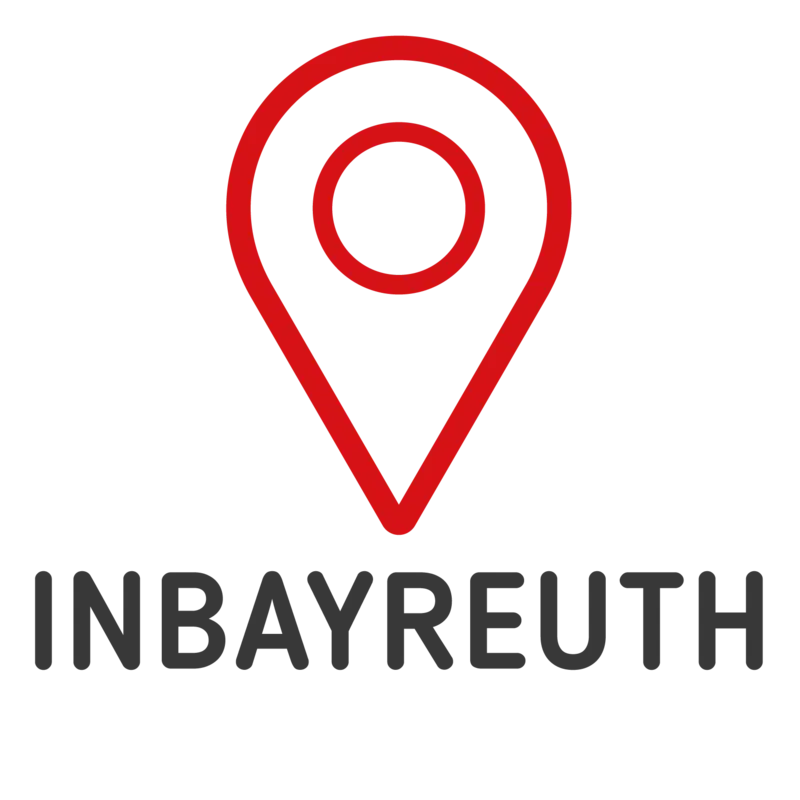Digitaler Nachlass 2026 – Was Erben jetzt wissen müssen
Der digitale Nachlass hat sich in den vergangenen Jahren von einer Randnotiz zu einem zentralen Thema der Nachlassabwicklung entwickelt. Nahezu jeder Mensch nutzt heute eine Vielzahl von Online-Diensten: Kommunikationsplattformen, Cloud-Speicher, E-Mail-Konten, Streaming-Abos, Konten bei Zahlungsdiensten, digitale Archivsysteme, soziale Netzwerke.
Der Zugriff auf diese Dienste ist häufig nicht nur eine Frage persönlicher Erinnerungen, sondern eine nüchterne Notwendigkeit: Rechnungen, Verträge, Versicherungsunterlagen und Zahlungsbestätigungen liegen vielfach ausschließlich digital vor. Damit stellt sich im Erbfall regelmäßig die Frage, wer auf diese Konten zugreifen darf – und in welchem Umfang.
Lange war die Rechtslage alles andere als klar. Anbieter sperrten Konten automatisch, verwandelten Profile in Gedenkzustände oder boten lediglich Datenpakete an, die nur einen Bruchteil der relevanten Informationen enthielten. Für die Erben bedeutete dies erhebliche Unsicherheiten. Besonders problematisch war, dass Plattformen häufig auf interne Richtlinien verwiesen, die den Zugang generell ausschließen oder stark beschränken sollten.
Die Rechtsprechung hat dieses Feld in den vergangenen Jahren schrittweise geordnet. Ausgangspunkt ist die inzwischen gefestigte Linie, dass digitale Konten grundsätzlich wie klassische Rechtsverhältnisse zu behandeln sind, die beim Tod des Nutzers in den Nachlass übergehen. Entscheidend ist nicht die technische Form, sondern der zugrunde liegende Vertrag. Mit dem Erbfall treten die Erben in diese Stellung ein – einschließlich der Berechtigung, auf die Inhalte zuzugreifen.
Die Gerichte haben dabei auch klargestellt, dass sich Anbieter nicht hinter Datenschutzargumenten verschanzen können. Die Vertraulichkeit des Kommunikationsinhalts schützt den Nutzer zu Lebzeiten, nicht aber gegenüber seinen Erben. Ebenso genügt es nicht, lediglich eine Datenkopie zur Verfügung zu stellen. Ein vollständiger Zugang zum Konto ist erforderlich, damit Erben ihre Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen können.
Aktuelle Entscheidungen gehen sogar noch weiter. Bei Social-Media-Profilen reicht es nicht, die Inhalte lediglich einzusehen. Wenn der zugrunde liegende Vertrag dies vorsieht, umfasst der digitale Nachlass auch die Möglichkeit der aktiven Nutzung.
Für die praktische Nachlassabwicklung bedeutet diese Entwicklung zweierlei. Erstens: Angehörige sind bei verweigertem Zugang nicht auf die Kulanz der Anbieter angewiesen. Sie können klare Ansprüche durchsetzen. Ob es um ein gesperrtes Social-Media-Profil, ein unzugängliches E-Mail-Konto oder einen Cloud-Speicher geht – die Tendenz der Rechtsprechung ist eindeutig. Zweitens: Vorsorge wird wichtiger. Wer festlegt, wer später auf seine digitalen Konten zugreifen darf und wo sich die relevanten Zugangsdaten befinden, reduziert Aufwand, Kosten und Streitpotenzial erheblich.
Damit lässt sich die Frage, die viele Jahre offen war, inzwischen klar beantworten: Was geschieht mit den zahlreichen digitalen Konten, die ein Mensch im Laufe seines Lebens anlegt? Die Antwort lautet: Sie sind Teil des Nachlasses. Sie werden nach denselben Grundsätzen behandelt wie analoge Unterlagen und Vermögenswerte. Und die Rechtsprechung sorgt zunehmend dafür, dass dieser Bereich nicht im Dunkeln bleibt, sondern verlässlich und rechtssicher abgewickelt werden kann.
Bestens beraten.
www.zeitler.law
Fachanwalt für Erbrecht & Familienrecht
Karl-Marx-Straße 7 - 95444 Bayreuth
Telefon: 0921/15 13 79-7