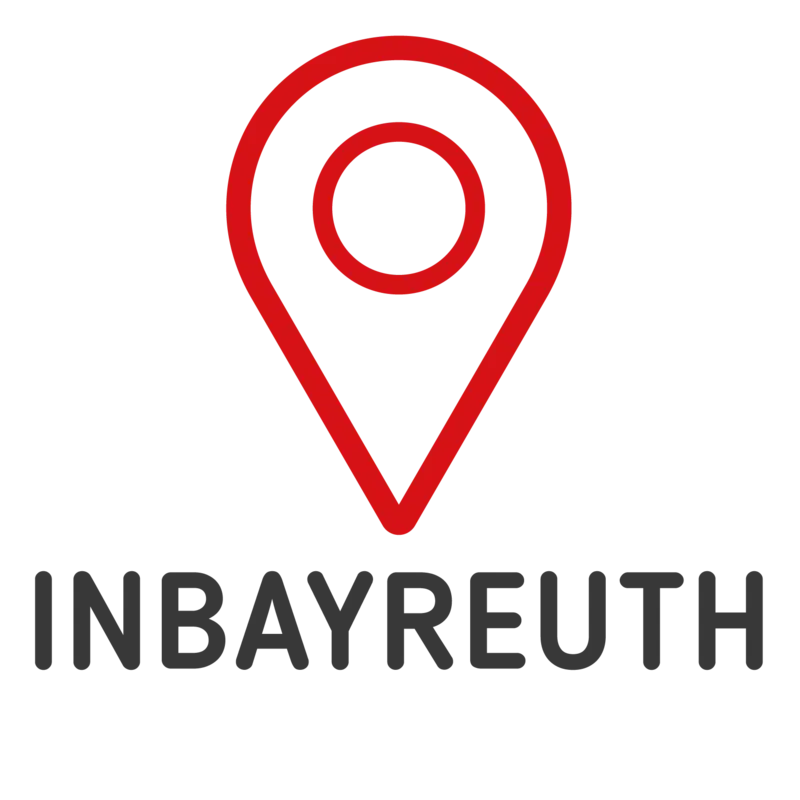Lipoprotein(a): Das oft übersehene Herzrisiko
Was ist Lipoprotein(a) – und warum ist es gefährlich?
Dr. Satanovskij: Lipoprotein(a), kurz Lp(a), ist ein Fett-Eiweiß-Teilchen im Blut, das dem „schlechten“ Cholesterin (LDL) ähnelt. Es trägt zusätzlich ein Eiweiß namens Apolipoprotein(a), das Lp(a) besonders tückisch macht: Es begünstigt Ablagerungen in den Arterien, wirkt entzündungsfördernd und kann die Gerinnung beeinflussen. Ein dauerhaft erhöhter Lp(a)-Wert erhöht damit das Risiko für z. B. Herzinfarkt und Schlaganfälle. Wichtig: Lp(a) ist erblich bedingt – es bleibt ein Leben lang weitgehend konstant und lässt sich durch Ernährung oder Lebensstil kaum verändern.
Wie häufig kommt es vor, was kann man selbst tun – und wer ist betroffen?
Dr. Satanovskij: Etwa 20 % der Bevölkerung haben ein erhöhtes Lp(a). Erhöhte Werte finden sich häufig familiär gehäuft, besonders bei Menschen mit frühen Herz- oder Gefäßerkrankungen oder erneuten Ereignissen trotz guter LDL-Werte. Lebensstilmaßnahmen können Lp(a) zwar nicht direkt senken, aber sie senken das Gesamtrisiko erheblich. Wichtig sind Nichtrauchen, normaler Blutdruck und Blutzucker, ausgewogene, pflanzenbetonte Ernährung, regelmäßige Bewegung und Stressreduktion. Auch das LDL-Cholesterin sollte so niedrig wie möglich sein – das kompensiert das unveränderliche Lp(a)-Risiko am besten.
Was kann man medikamentös aktuell machen – und was kommt in Zukunft?
Dr. Satanovskij: Klassische Cholesterinsenker wie Statine oder Ezetimib senken Lp(a) nicht. Etwas wirksamer sind PCSK9-Antikörper und Inclisiran, die Lp(a) um etwa 15–30 % reduzieren können – offiziell sind sie jedoch nicht dafür zugelassen. Das ältere Mittel Niacin wird wegen Nebenwirkungen und fehlendem Nutzen heute nicht mehr empfohlen. Bis wir gezielte Medikamente haben, bleibt entscheidend, alle anderen Risikofaktoren konsequent zu behandeln – vor allem LDL-Cholesterin, Blutdruck und Blutzucker. So lässt sich das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich senken. Die Zukunft ist sehr vielversprechend: Neue Medikamente wie Pelacarsen (Antisense-Oligonukleotid) oder Olpasiran und Zerlasiran (siRNA-Wirkstoffe) können die Lp(a)-Produktion in der Leber blockieren und den Spiegel um bis zu 90 % senken. Die entscheidenden Endpunktstudien, die zeigen sollen, ob diese starke Senkung auch tatsächlich zu weniger Herzinfarkten und Schlaganfällen führt, laufen derzeit noch; mit Ergebnissen wird 2026 gerechnet. Bei erfolgreicher Prüfung könnten die ersten spezifischen Lp(a)-Therapien schon in wenigen Jahren zur Verfügung stehen.
Welche Alternativen zu Medikamenten gibt es?
Dr. Satanovskij: Es gibt noch die Lipidapherese. Das ist ein spezielles Verfahren (Blutwäsche), bei dem wir das Blut über ein Filtersystem leiten und LDL-Cholesterin, Lp(a), etc. entfernen. Eine Sitzung führt typischerweise zu einer Senkung um etwa 60–80 %, der Wert steigt zwischen den Sitzungen wieder an. Die Behandlung erfolgt meist wöchentlich in spezialisierten Zentren und dauert in der Regel 2–3 Stunden. Geeignet ist die Lipidapherese für hochgradig gefährdete Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Lp(a) und fortschreitender Gefäßerkrankung trotz optimaler medikamentöser Therapie, insbesondere nach Herzinfarkt/Bypass/Stent oder bei wiederholten Herz-Kreislauf-Ereignissen. Außerdem wird die Lipidapherese eingesetzt bei Patienten, welche unter Medikamentenunverträglichkeiten leiden. Bei den meisten Patientinnen und Patienten, die dauerhaft die Lipidapherese durchführen lassen, ereignen sich im Verlauf keine neuen Herzkreislaufereignisse wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle mehr.
Unter welchen Voraussetzungen zahlt die Krankenkasse – und wie läuft der Antrag?
Dr. Satanovskij: In Deutschland werden die Kosten für Lipidapherese bei Lp(a)-Hyperlipoproteinämie übernommen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Es braucht:
• hohes Lp(a) (häufig genannte Schwelle z. B. > 60 mg/dl beziehungsweise > ~120–150 nmol/l), und
• klinisch belegte, fortschreitende atherosklerotische Erkrankung (z. B. wiederholte Herz-Kreislauf-Ereignisse), trotz optimaler medikamentöser und lebensstilbezogener Therapie
Der Antrag auf eine Lipidapherese wird von uns gestellt. Dafür werden alle wichtigen Unterlagen zusammengestellt – also Laborwerte, ärztliche Befunde, Bildgebung und eine Dokumentation der bisherigen Behandlungen, die trotz optimaler Therapie keine ausreichende Wirkung gezeigt haben. Der Antrag wird anschließend an eine spezielle Lipid-Kommission weitergeleitet, die bei der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet ist. Diese Kommission besteht aus Kardiologen und Nephrologen und prüft, ob die Voraussetzungen für eine Lipidapherese erfüllt sind.Wird der Antrag bewilligt, übernimmt die Krankenkasse die Kosten der Behandlung – in der Regel zunächst für ein Jahr. Danach muss die Genehmigung erneuert werden, damit überprüft werden kann, ob die Therapie weiterhin notwendig ist und gut wirkt.
Wer sollte sich testen lassen?
Dr. Satanovskij: Entsprechend der Empfehlung kardiologischer Fachgesellschaften gilt: Jeder Mensch sollte Lp(a) mindestens einmal im Leben messen lassen. Das ist sinnvoll, weil der Wert genetisch festgelegt ist und eine einmalige Messung meist reicht. Häufig erfolgt dies über den Hausarzt, den Kardiologen oder den Nephrologen.
Besonders dringend empfehle ich die Bestimmung bei:
Herzinfarkt/Schlaganfall in der Familie in jungen Jahren (Männer < 55, Frauen < 65), eigener Atherosklerose trotz „normalem“ LDL, verkalkter Aortenklappe, wiederholten Ereignissen trotz guter Standardtherapie, und bei Personen, die ihr kardiovaskuläres Risiko grundsätzlich gut kennen möchten.
Die Messung ist einfach: normale Blutabnahme, keine Nüchternheit nötig. Das Ergebnis besprechen wir dann im Gesamtkontext: Lp(a) ist ein Risikofaktor unter mehreren. Entscheidend bleibt das Gesamtpaket aus u.a. Lebensstil, Vorerkrankungen, Blutdruck, Blutzucker und LDL-Zielwerten. Letztlich gilt: Sie sollten Ihr Risiko kennen und im Zweifel bei Ihrem Arzt nachfragen.
Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie
Nephrologische Praxis und DialyseCentrum in der Spinnerei
Spinnereistraße 7
95445 Bayreuth
- Telefon: 0921-507202-0
- Fax: 0921-507202-10
- info@dialysecentrum.de
- www.dialysecentrum.de