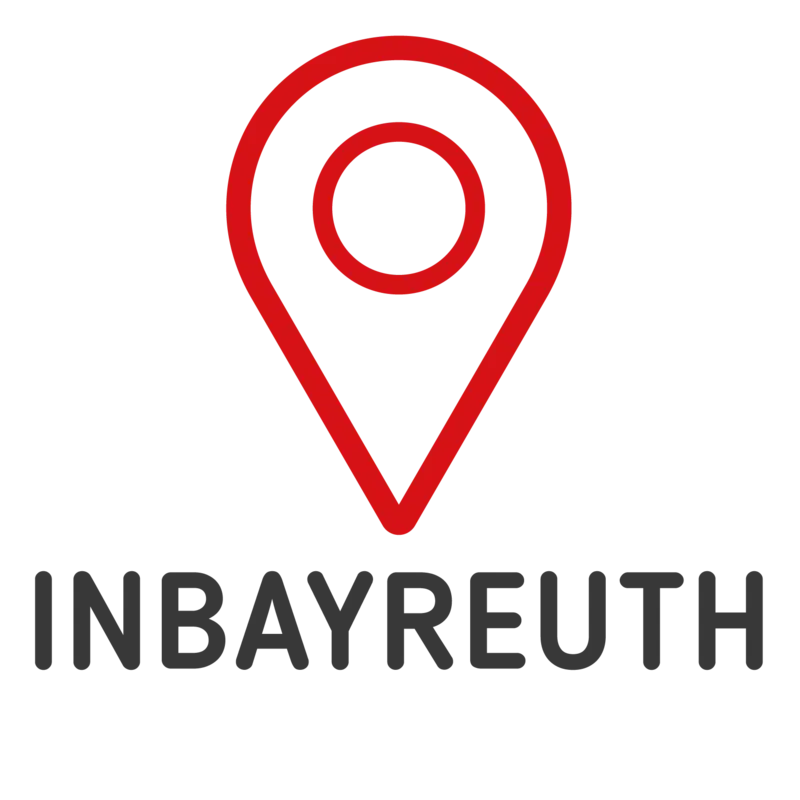Anspruch auf „Miete“ beim Auszug aus dem gemeinsamen Haus
Sind Ehegatten Eigentümer einer gemeinsamen Wohnung oder eines Hauses, stellt sich im Falle einer Trennung die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe der Ehegatte, der auszieht, einen Anspruch, gegen den in der Wohnung oder im Haus verbleibenden Ehegatten hat.
Derjenige Ehegatte, der in der gemeinsamen Immobilie bleibt, spart sich die Kosten für eine Mietwohnung. Das mietfreie Wohnen stellt unterhaltsrechtlich relevantes Einkommen dar, soweit die ersparte Miete die Kosten (z.B. für Darlehen) übersteigt.
Grundsätzlich steht dem ausziehenden Ehegatten eine Vergütung für die Nutzung gegen den anderen Ehegatten zu. Dies ist gesetzlich in § 1361 b Abs. 3 Satz 2 BGB geregelt. In der Praxis besteht häufig eine Konkurrenz bzw. Wechselwirkung zwischen dem Anspruch auf Zahlung einer Nutzungsvergütung und dem Unterhaltsanspruch.
Zu dieser Thematik gibt es eine neuere Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 27.11.2024 (Az. XII ZB 28/23). Danach besteht ein Vorrang der Unterhaltsregelung vor der Nutzungsvergütung, um zwischen den Ehegatten einen angemessenen Ausgleich für den Wohnvorteil zu bewirken.
Danach kann es einen Unterschied machen, ob zuerst der Nutzungsausfall durch den Unterhaltspflichtigen geltend gemacht wird oder der Unterhalt durch den Unterhaltsberechtigten. Aus diesem Grund sollte bei gemeinsamem Eigentum und im Raum stehenden Unterhaltsansprüchen, immer eine anwaltliche Beratung erfolgen, um kein Geld zu verschenken.
Wird erst der Nutzungsausfall geltend gemacht, erfolgt nach der Rechtsprechung des BGH nur eine überschlägige Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Ehegatten zur Berechnung der hypothetischen Unterhaltsansprüche.
Bleibt beispielsweise der unterhaltsberechtigte Ehegatte in der Immobilie und verlangt Unterhalt, während der unterhaltspflichtige Ehegatte eine Nutzungsentschädigung geltend machen könnte, hat dies folgende Konsequenzen: Haben sich die Ehegatten auf eine bestimmte Unterhaltszahlung verständigt oder wurde der Unterhalt gerichtlich angeordnet und wurde der Wohnvorteil bei der Unterhaltsberechnung bereits berücksichtigt, kann keine Nutzungsentschädigung mehr verlangt werden.
Der Wohnvorteil findet bei der Unterhaltsberechnung dadurch seinen Niederschlag, dass dem in der Wohnung lebenden Ehegatten ein sogenannter Wohnwert zugerechnet wird. Zur Ermittlung der Höhe des Wohnwertes ist zwischen dem Zeitraum bis zur Zustellung des Scheidungsantrages und dem Zeitraum danach zu unterscheiden.
Im Trennungsjahr wird dem in der Ehewohnung verbliebenen Partner nur ein sogenannter angemessener Wohnwert im Rahmen der Unterhaltsberechnung als Einkommensbestandteil hinzugerechnet. Nach Ablauf des Trennungsjahres/Zustellung des Scheidungsantrages ist mit dem objektiven Wohnwert zu rechnen. Der objektive Wohnwert entspricht der für eine vergleichbare Immobilie zu zahlenden Nettokaltmiete. Für den angemessenen Wohnwert wird in der Regel nur die Hälfte hiervon berücksichtigt.
Anders ist es allerdings, wenn der Wohnwert nicht im Rahmen des Unterhalts berücksichtigt wurde. Der Miteigentümer, der ausgezogen ist, kann dann eine Nutzungsentschädigung geltend machen. Allerdings erfolgt auch in diesem Fall nach der Vorgabe des Bundesgerichtshofs eine fiktive Berechnung von Trennungsunterhaltsansprüchen.