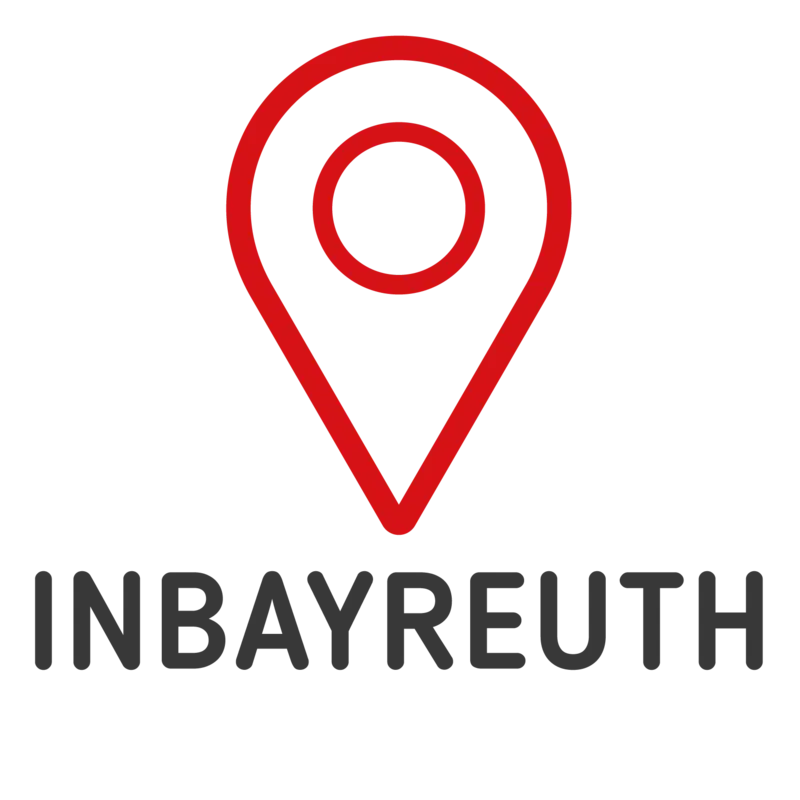Präzision auch hinter der Bühne
Wenn auf dem Grünen Hügel die ersten Takte erklingen, ist alles perfekt ausgeleuchtet, millimetergenau aufgebaut und bereit für große Oper. Diese Perfektion ist nur möglich durch ein engmaschiges technisches Sicherheitsnetz. Henning Angebrandt, Technischer Direktor der Bayreuther Festspiele, gibt einen Einblick in den komplexen Ablauf hinter einer Opernbühne – und in die unsichtbare Arbeit, die weit vor dem ersten Vorhang beginnt.
Keine Oper ohne Regeln
„Die Sicherheit auf der Bühne ist streng geregelt“, sagt Henning Angebrandt. Gemeint sind nicht nur Brandschutz und Achtsamkeit bei der Verwendung von Pyrotechnik, sondern das große Ganze: von der Versammlungsstättenverordnung über Richtlinien der Berufsgenossenschaften bis hin zur Gefährdungsbeurteilung. „Das sind Grundlagen für unsere Entscheidungen: Ist eine Situation gefährlich oder nicht? Und vor allem: Wer trägt die Verantwortung, sollte es tatsächlich zu einem Unfall kommen?“ Auch Regisseurinnen und Regisseure stehen in der Pflicht, wenn durch künstlerische Ideen die Sicherheit gefährdet wird.
Auf einer Festspielbühne, wo regelmäßig Bühnenbauten mit großer Höhe entstehen oder Sänger über fahrbare Plattformen gleiten, kann jeder Fehler potenziell folgenschwere Konsequenzen haben. „Wenn wir ein Flugwerk bauen, mit dem der Künstler zum Schweben gebracht wird, bringen wir eine Maschine in Verkehr. Dann braucht es eine Vor- und Bauprüfung und eine Sachverständigenabnahme – das ist ähnlich wie der TÜV beim Auto.“ Doch nicht alles kann selbst erledigt werden: „In unseren elektronischen Steuerungen stecken Blackboxen, die wir nicht einsehen können. Da muss die Herstellerfirma die jährliche Sachkundigenprüfung übernehmen und uns bestätigen, dass alles einwandfrei funktioniert.“ Diese Blackboxen protokollieren nicht nur jede Bewegung und jede Störung, sie sind das Herzstück einer sicherheitsrelevanten Steuerung – im Fall der Fälle lassen sich damit Fehler und somit auch Ursachen rekonstruieren. Ob eine fehlerhafte Programmierung oder ein technisches Problem vorlag, lässt sich so eindeutig herausfinden.
Wer hoch hinaus will, muss standfest sein
Sicherheit bedeutet auch Fürsorge. Wer auf der Bühne in großer Höhe agieren soll, muss schwindelfrei sein: „Ein einfaches Beispiel: Wer Höhenangst hat, sollte nicht zehn Meter über dem Boden singen und agieren müssen.“ Daher dürfen nur befähigte Personen zum Einsatz kommen. „Wenn sich Sängerinnen und Sänger in ihrer Rolle nicht wohlfühlen und die Darbietung darunter leiden könnte, muss sich der Regisseur oder die Regisseurin etwas anderes einfallen lassen, um die Darstellung für die Künstler spielbar zu gestalten.“ Henning Angebrandt plädiert für Ehrlichkeit: „Wir weisen unsere Sängerinnen und Sänger gerne darauf hin, zu sagen, wenn sie sich unwohl fühlen. Es hilft niemandem, wenn jemand vor dem Auftritt nicht den Kopf frei hat von Ängsten.“ Viele schwierige Situationen müssen ausreichend geprobt werden, damit Angst erst gar nicht aufkommt. Auch technische Hilfen, etwa ein Haltegriff oder ein Haltegurt, können die Situation entschärfen.
Künstlerische Vision trifft physikalische Realität
Auch im Dialog mit den Bühnenbildnerinnen und -bildnern geht es um mehr als Ästhetik. „Manchmal muss der Techniker sagen: ‚Das geht nicht‘“, erklärt Henning Angebrandt. „Dann reden wir darüber, warum. Und dann findet man meistens einen Weg.“ Denn auf der realen Bühne gelten die Gesetze der Physik. „Wir sind nicht im Filmstudio und nicht im Videospiel. Wir können nicht alles machen, was vielleicht gewünscht wird.“
Sicherheit als Teil der Kunst
Sicherheit ist nicht nur technische Notwendigkeit – sie ist Teil des künstlerischen Prozesses. Sie verlangt vorausschauendes Denken, klare Kommunikation und die Fähigkeit, künstlerische Wünsche mit realen Bedingungen abzugleichen. Und sie ist, wie so vieles in der „Werkstatt Bayreuth“, ein Gemeinschaftswerk. „Sicherheit ist bei uns ein Qualitätsmerkmal. Sie macht möglich, was das Publikum schließlich als das Besondere im Festspielhaus erlebt.“