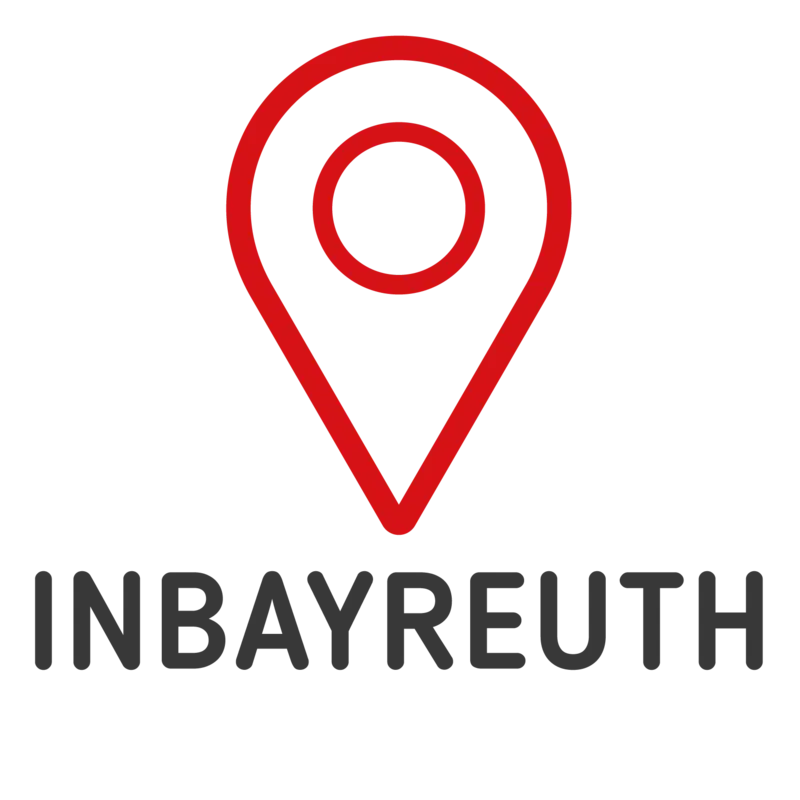Monumentaloper und kulturelles Streitobjekt
Aus ganz Europa reisten sie 1868 an, manche gar von Übersee. Denn Richard Wagner hat gerufen, sein neustes Werk „Die Meistersinger von Nürnberg“ steht in München zur Uraufführung bereit. Ein Spektakel wird erwartet und für die Wagnerverehrer der Zeit ein Pflichttermin. Auch, weil man Teil des Siegeszuges sein will, den diese Oper fortan begleiten wird. Denn dass sich hier in München der Vorhang für ein Meisterwerk heben wird, steht für die Wagner-Jünger schon vor der Anreise fest. Zumal das Stück auch heiter sein soll, ja sogar kurzweilig – das behauptet im Vorfeld zumindest Dirigent Hans von Bülow. Gut, dagegen steht die Aufführungsdauer von rund viereinhalb Stunden – ohne Pausen, wohlgemerkt – aber das kennt man bereits.
Der Meister selbst ist an diesem 21. Juni 1868 ebenfalls vor Ort, er hat die Proben im Münchner Nationaltheater überwacht. Und als wäre die Uraufführung nicht Stress genug, wohnt Wagner in diesen Tagen ausgerechnet bei seinem ergebenen Freund Hans von Bülow, dem er jüngst die Frau ausgespannt hat. Zugegeben, die Ehe existierte nur noch auf dem Papier, denn Bülows Frau Cosima hat zu diesem Zeitpunkt Wagner schon zwei Kinder – Isolde und Eva – geboren, doch die Situation ist pikant.
Pikant ist – so wird das zumindest von Teilen des Publikums empfunden – das Sujet der Oper. Bietet doch darin ein Vater seine Tochter öffentlich dar, der Wettstreit ums beste Lied ist zugleich Wettstreit um die Hand der Tochter. Diese wird dazu selbstverständlich weder gehört noch gefragt. Wagner nutzt für sein monumentales Werk historische Quellen, lehnt sich aber nur lose an diese an. Vieles ist frei erfunden, wie etwa die Figur des Sixtus Beckmesser, eine bitterböse Karikatur von Wagners Kritikern, mit der er vor allem auf seinen berühmtesten Gegner zielt, Eduard Hanslick. Der schreibt prompt, die Meistersinger seien „unschön und unmusikalisch“, die Monologe des Hans Sachs „unaussprechlich langweilig“. Andere Kritiker werden deutlicher: Von „kolossaler Ratte“, von „Monstrum“ und „Katzenmusik“ ist die Rede. Das kommt nicht von ungefähr, ist in diese Oper textlich viel hineingepackt: Abgründiges über die Verführbarkeit der Masse, Tiefsinniges über die Kunst, aber auch Deutschtümelei. Insgesamt viereinhalb Stunden Wettstreit der Dichtkunst und der Liebe.
Dennoch, die Uraufführung ist Triumph und rauschendes Fest zugleich, nicht zuletzt dank des Mäzenatentums von König Ludwig II.. Obwohl die Oper polarisiert, setzt sie zu einem Siegeszug an. Sie wird in den folgenden Jahren in Dresden, Berlin, Wien, Prag, sogar in Kopenhagen aufgeführt und gilt schnell, neben Carl Maria von Webers „Freischütz“, als Inbegriff der deutschen
Nationaloper.
Eine besondere Herausforderung für jede Produktion ist die schiere Größe der Oper. Die Besetzung ist riesig, die Bühnenbilder erfordern Opulenz, und die musikalischen Anforderungen an Orchester und Sänger enorm. Ein Werk, das sowohl Können als auch eine Portion Selbstüberschätzung erfordert. Dazu passt auch Wagners irrige Annahme, dass seine „Meistersinger“ überall und leicht zu inszenieren seien.
Inhaltlich eine Geschichte der politischen Vereinnahmung von stramm hirnlosen Patrioten, Nationalsozialisten. Der Bayreuther Stammgast Adolf Hitler berauschte sich in den „Meistersingern“ an deutscher Hybris und Arroganz. Zentrale Fundstelle für diese militante Deutschtümmelei ist das Jubelfinale der Oper, eine Art Volksfest der Nürnberger Zünfte und ihrer Meister sowie die dahingehend interpretierte Schlussansprache des Schustermeisters und Philosophen Hans Sachs. Eine Lesart, die bis heute zu Kontroversen führt und in zahlreichen Inszenierungen aufgegriffen und aufgearbeitet wurde. Gerne auch provokant, wie etwa 2002 in Hamburg, als Regisseur Peter Konwitschny die Aufführung unterbrechen ließ und die Darsteller minutenlang auf offener Bühne die fatale Wirkung dieser Oper diskutierten. Damals ein Eklat.
Aller Widrigkeiten und Kontroversen zum Trotz haben sich die „Meistersinger“ ihren Platz im Repertoire der großen Opernhäuser erobert. Und so sitzen auch heute noch Opernbesucher, mal schmunzelnd, mal schenkelklopfend, mal mit gerunzelter Stirn, mal auch gelangweilt, vor der Bühne und sehen und hören der Geschichte von Walther, Eva und Hans Sachs zu.