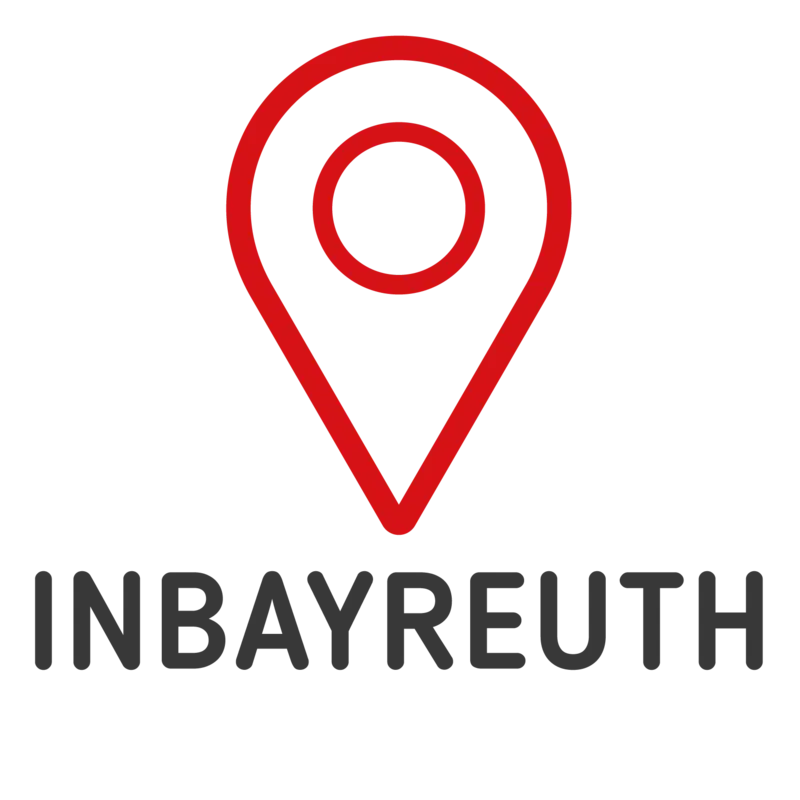Finanznot bedroht Friedhof
Der Friedhof in St. Georgen, ein Ort tief verwurzelter Geschichte und jahrhundertealter Bestattungskultur, steht vor einer ungewissen Zukunft. Entgegen mancher Befürchtungen wird der Gottesacker nicht geschlossen – doch der Fortbestand in kirchlicher Trägerschaft ist fraglich. Wie der Bayreuther Dekan Jürgen Hacker erklärt, befindet sich die Evangelisch-
Lutherische Gesamtkirchengemeinde Bayreuth seit Längerem im Austausch mit der Stadt, um gemeinsam tragfähige Perspektiven für die Zukunft der Friedhofslandschaft zu entwickeln. Die evangelische Bevölkerung trägt ausschließlich die Kosten für drei kirchliche Friedhöfe in der Stadt. Staatliche oder kommunale Zuschüsse gibt es nicht. „Der Beitrag der evangelischen Bevölkerung für die Zivilgesellschaft wurde bisher nicht so richtig wahrgenommen und gewürdigt,“ so Dekan Jürgen Hacker.
Wandel der Bestattungskultur
Über 80 Prozent der Verstorbenen werden heute in Urnen beigesetzt – Tendenz steigend. Diese Form erfordert weniger Platz und Infrastruktur. Der Aufwand für Pflege, Personal, Wegerhaltung und Gebäudeunterhalt bleibt aber auf einem hohen Niveau. Die Kostenstruktur hinkt dem Wandel hinterher: Bei der Grabvergabe werden oft nur die individuellen Grabkosten berücksichtigt – nicht aber die anteilige Finanzierung der gesamten Anlage. „Wenn man eine Eigentumswohnung kauft, bezahlt man auch nicht nur die Wohnung, sondern beteiligt sich an der gesamten Hausinfrastruktur“, erklärt Dekan Hacker, „beim Friedhof wird dies so nicht angewandt.“
Die Zahl der evangelischen Christen in Bayreuth liegt noch bei etwa 37 Prozent der Stadtbevölkerung. Auch Angehörige anderer Konfessionen, Religionen, Konfessionslose und Muslime, finden auf den evangelischen Friedhöfen in Bayreuth ihre letzte Ruhe – in St. Georgen gibt es dafür sogar ein gesondertes Grabfeld.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde in die Bayreuther Friedhöfe seitens der Evangelischen Kirche zudem Millionenbeträge investiert. Neue Sanierungsmaßnahmen, zum Beispiel am Friedhofsgebäude in St. Georgen, zeichnen sich ab.
Schwierige Nachnutzung
Wenn in St. Georgen künftig keine Bestattungen mehr vorgenommen werden, stellt sich die Frage, was aus dem historischen Areal künftig werden soll. Friedhöfe sind keine leicht wandelbaren Flächen. Ihr Denkmalwert, ihre religiöse Prägung und die emotionale Bedeutung für viele Angehörige, erschweren eine Nachnutzung erheblich. Ein Umbau zu Parkanlagen oder eine Umwidmung zu anderen Zwecken ist sensibel und bedarf umfassender Abstimmung – auch mit Blick auf die Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof St. Georgen.
Der Friedhof St. Georgen wurde 1709 als Ruhestätte der damals eigenständigen Gemeinde „Sankt Georgen am See“ angelegt. Ab Herbst 1944 wurden Kriegstote, die in Bayreuther Lazaretten verstorben waren, in St. Georgen bestattet. Auch Opfer der Fliegerangriffe vom April desselben Jahres fanden hier ihre letzte Ruhe. 1951 begann der Volksbund mit dem Ausbau einer Kriegsgräberstätte. Heute steht der Friedhof mit seinen zahlreichen kunsthistorisch bedeutsamen Grabmalen und der barocken Friedhofs-mauer unter Denkmalschutz und er ist in die Liste „Immaterielles Erbe Friedhofskultur“ aufgenommen.
Kommunale Lösungen
In vielen bayerischen Städten liegt die Friedhofsträgerschaft bereits in kommunaler Hand. Öffentlich getragene Friedhöfe könnten langfristig stabiler finanziert werden. Der Friedhof St. Georgen wird als solcher sicher erhalten bleiben – doch seine Zukunft als kirchlich verwaltete Begräbnisstätte ist zumindest fraglich. „Gespräche mit der Stadt laufen“, sagt Dekan Hacker. Ein einfaches ,Weiter so‘ scheint jedoch keine Option mehr zu sein.