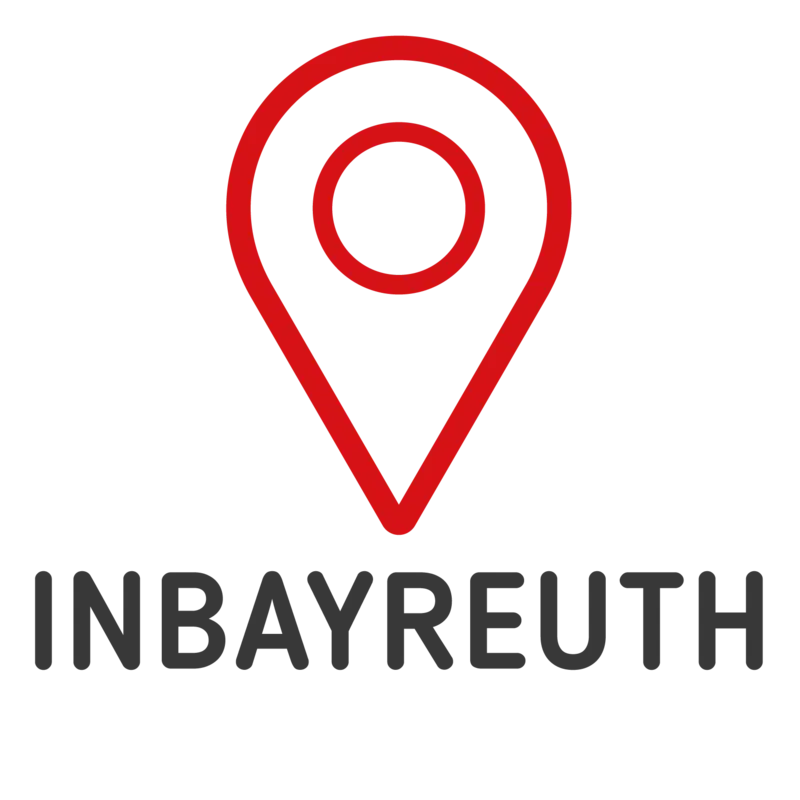Streit ums Erbe: Aktuelles aus dem Gerichtssaal
Ob es um ein testamentarisches Hausverbot für den Partner des Erben geht, Pflichtteilsentziehung wegen groben Undanks oder die Frage, ob ein unleser-
liches Gekritzel ein gültiges Testament ist: Wenn Familien über den letzten Willen streiten, müssen oft die Gerichte entscheiden – und ihre Urteile sind manchmal spannender als jeder Krimi.
Sittenwidrige Auflage
Eine Mutter vererbte ihrer Tochter ein Haus, knüpfte daran aber eine Bedingung: Die Tochter müsse ihrem Lebensgefährten ein lebenslanges Hausverbot erteilen. Die Tochter zog vor Gericht, um diese Auflage für nichtig erklären zu lassen.
Das Gericht gab der Tochter recht. Die Auflage ist sittenwidrig und damit nichtig. Sie greift in unzulässiger Weise in den höchstpersönlichen Lebensbereich und die freie Lebensgestaltung der Tochter ein. Der letzte Wille des Erblassers hat Grenzen, wenn er die Grundrechte der Erben verletzt.
Der Fall zeigt eindrücklich, dass man im Testament nicht alles anordnen kann. Persönliche Abneigungen des Erblassers dürfen nicht dazu führen, die Lebensführung der Erben auf unzumutbare Weise zu diktieren.
Pflichtteil-Entzug gescheitert
Ein Vater enterbte seine Kinder in einem Testament und entzog ihnen zusätzlich den Pflichtteil wegen „groben Undanks“. Später versöhnte er sich wieder mit ihnen. Nach seinem Tod argumentierten die Kinder, durch die Versöhnung sei das gesamte Testament hinfällig und sie würden nach der gesetzlichen Erbfolge alles erben.
Das Gericht machte eine wichtige Unterscheidung: Durch die Versöhnung wird zwar der Grund für den Pflichtteilsentzug hinfällig, aber nicht automatisch die Enterbung an sich. Eine Enterbung ist eine reine Anordnung, die keiner Begründung bedarf. Das Ergebnis: Die Kinder bleiben enterbt, haben aber nun wieder Anspruch auf ihren Pflichtteil (die Hälfte des gesetzlichen Erbteils).
Der Fall erklärt wunderbar den Unterschied zwischen Ent-
erbung und Pflichtteilsentzug – ein Detail mit enormen finanziellen Auswirkungen.
Das unleserliche Testament
Ein handschriftliches Testament war so krakelig und schwer lesbar, dass unklar war, wer eigentlich Erbe sein sollte. Ein potenzieller Erbe beantragte einen Erbschein zu seinen Gunsten, während andere sagten, das
Dokument sei unleserlich und damit ungültig.
Das Gericht betonte, dass ein Testament nicht „schön“ geschrieben sein muss. Solange der Wille des Erblassers durch Auslegung – notfalls mit Hilfe von Sachverständigen für Handschriften – noch irgendwie ermittelt werden kann, ist es gültig. Nur wenn der Inhalt absolut nicht mehr entzifferbar ist, verliert es seine Wirkung. Im konkreten Fall konnte der Wille noch ermittelt werden. Dieser Fall beruhigt viele, die sich Sorgen um ihre nicht perfekte Handschrift machen, und zeigt, wie viel Mühe sich Gerichte geben, den wahren Willen eines Verstorbenen zu respektieren.
Pflege gegen Erbe
Eine Nichte pflegte ihre Tante jahrelang aufopferungsvoll. Die Tante hatte sie in einem notariellen Testament als Alleinerbin eingesetzt. Kurz vor ihrem Tod, bereits schwer dement, errichtete die Tante ein neues handschriftliches Testament, in dem plötzlich ein Nachbar alles erben sollte. Die Nichte focht dieses neue Testament an. Das Gericht gab der Nichte recht. Aufgrund von ärztlichen Gutachten kam es zu dem Schluss, dass die Tante zum Zeitpunkt der Errichtung des zweiten Testaments bereits testierunfähig war. Sie konnte die Tragweite ihrer Entscheidung nicht mehr verstehen. Damit war das neue Testament unwirksam und die Nichte erbte auf Grundlage eines älteren Testaments.
Der Fall beleuchtet häufige Problem der Testierunfähigkeit. Er zeigt, wie wichtig ärztliche Zeugnisse in diesen Fällen sein können.