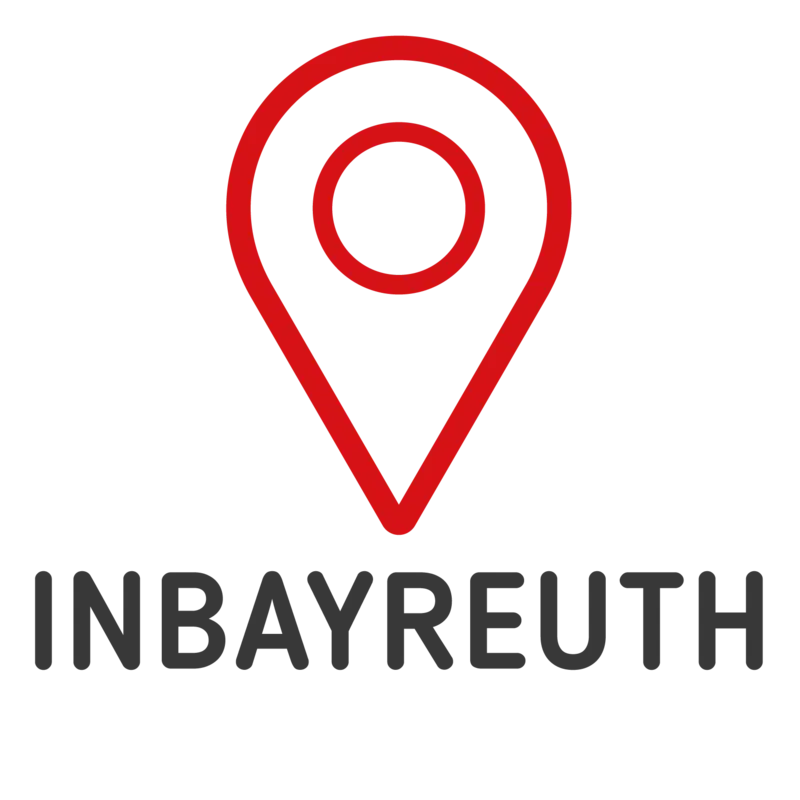Prostatakarzinom - Neues zum häufigsten Tumor des Mannes
Prof. Dr. Claus Fischer Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie der Klinikum Bayreuth GmbH
Mit rund 60.000 Neuerkrankungen jährlich ist das Pros-tatakarzinom der häufigste bösartige Tumor bei Männern und bereits heute die dritthäufigste Krebserkrankung überhaupt. Obwohl die meisten Betroffenen älter als 70 Jahre sind, trifft es immer wieder auch jüngere Männer. Ab dem 45. Lebensjahr sollte daher jeder Mann regelmäßig zur Vorsorge gehen, rät Prof. Dr. Claus Fischer, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie der Klinikum Bayreuth GmbH. Am kommenden Mittwoch, 17. Juli, spricht er um 18 Uhr im Rahmen eines Medizinischen Vortags über Diagnosemöglichkeiten und Behandlungsalternativen. BTSZ: Herr Prof. Fischer, Vorsorge ist wichtig, keine Frage. Sie sehen hier aber Handlungsbedarf. Warum? Prof. Fischer: Vorsorge bedeutet in der Regel, dass der Hausarzt die Prostata abtastet. Leider lässt sich ein Karzinom so oft erst erkennen, wenn es schon fast zu spät ist. Sinnvoll wäre es daher, zusätzlich den PSA-Wert im Blut zu bestimmen. PSA steht für Prostataspezifisches Antigen, ein Eiweiß, das nur in den Zellen der Prostata gebildet wird. Leider ist das bisher keine Kassenleistung und kostet rund 20 Euro. Aber es kann Leben retten. Denn je eher die Erkrankung erkannt wird, desto besser die Heilungschancen. BTSZ: Wenn der PSA-Wert erhöht ist, habe ich dann Krebs? Prof. Fischer: Nicht unbedingt. Auch eine altersbedingt vergrößerte Prostata oder eine Entzündung verursachen einen erhöhten Wert. Oder schlicht eine lange Fahrradtour. Es ist Aufgabe des Arztes, das zu hinterfragen. Eine weitere Abklärung beim Urologen ist bei einem erhöhten PSA-Wert aber in jedem Fall sinnvoll und wichtig. BTSZ: Was wird der Urologe dann tun? Prof. Fischer: In der Regel ordnet er eine Probenentnahme aus der Prostata an. Das ist ein ambulanter Eingriff, den jeder Urologe vornehmen kann. Dennoch: es bleibt ein Eingriff, der auch Komplikationen mit sich bringen kann – und vor dem sich viele Patienten scheuen, weil er zugegebenermaßen auch unangenehm ist. BTSZ: Aber gibt es denn Alternativen? Prof. Fischer: Theoretisch, ja. Mit Hilfe einer MRT-Untersuchung beim Radiologen lässt sich beispielsweise ein Schnittbild der Prostata erstellen. Eine Probenentnahme würde dann nur noch bei Auffälligkeiten als zusätzliche Abklärung notwendig. Eine weitere Alternative bietet die Nuklearmedizin: Sie macht es möglich, auch kleinste Herde oder Absiedlungen eines Prostatakarzinoms aufzuspüren. Ein prostataspezifisches Membranantigen (PSMA) wird als Tracer in die Vene injiziert und sein Weg im Körper nachvollzogen. Auch befallene Lymphknoten können so zuverlässig entdeckt und Rezidive aufgespürt werden. In meinen Augen haben beide Alternativen großes Potenzial, entsprechen aber leider derzeit noch nicht in jeder Hinsicht dem standardmäßigen Vorgehen. BTSZ: Wie geht es weiter, wenn tatsächlich Krebs diagnostiziert wird? Prof. Fischer: Dann muss zunächst entschieden werden, ob eine Behandlung sinnvoll ist. Dazu muss man wissen: Prostatakarzinome wachsen oft sehr langsam. Bei älteren Patienten kann es daher durchaus ratsam sein, aktiv zuzuwarten. Im Grunde heißt das, man beobachtet regelmäßig, wie sich der Tumor entwickelt und entscheidet immer wieder neu, ob eine Therapie notwendig ist. Einem Teil der Betroffenen kann man so eine aufwändige Behandlung ersparen. Diese Chance hat aber nur, wer die regelmäßige Vorsorge beim Urologen wahrnimmt. BTSZ: Wenn eine Behandlung dennoch notwendig ist – welche Möglichkeiten gibt es? Prof. Fischer: Will man ein Prostatakarzinom heilen, muss in der Regel die befallene Drüse vollständig entfernt oder der Tumor gezielt durch die Haut bestrahlt werden. Beide Methoden sind aufwändig und haben sowohl Vor- als auch Nachteile. Darauf werde ich in meinem Vortrag eingehen. Die Möglichkeiten entwickeln sich aber weiter. Mittels Ultraschall oder Laser soll es möglich werden, nur tatsächlich betroffene Areale lokal zu behandeln. Derzeit befinden sich diese Alternativen noch in einem experimentellen Stadium. Wir wissen also noch nicht abschließend, ob sie sich durchsetzen werden. Für die Patienten wäre es eine enorme Verbesserung.