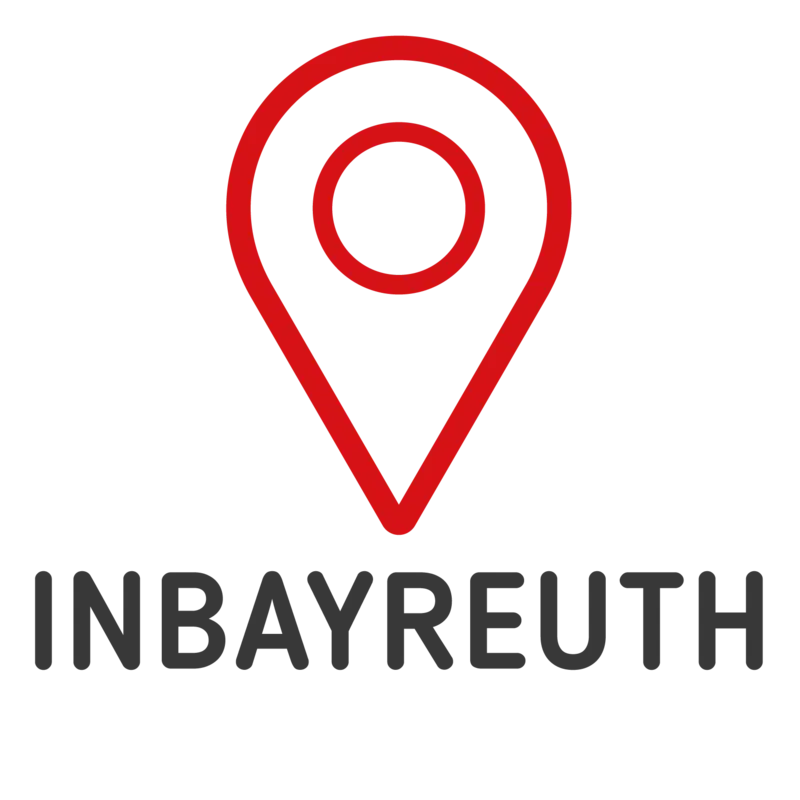Ratgeber Gesundheit: Wenn das Mutterglück ausbleibt – Hilfe bei Wochenbettdepression
Stephanie Tieden Oberärztin im Depressionszentrum am Bezirkskrankenhaus Bayreuth Nordring 2, 95445 Bayreuth 0921/283-0
Friedlich schlummert das Baby in Mamas Arm. Sie beugt sich liebevoll hinab. So stellen sich wohl viele das größte Mutterglück vor. Aber was, wenn das nicht so ist? Wenn Schlafentzug, Überforderung und Stress die Oberhand gewinnen. Dann sollte man auf sich Acht geben und Hilfe suchen, sagt Dr. Stephanie Tieden, Oberärztin der Depressionsstation am Bezirkskrankenhaus in Bayreuth. Größtes Mutterglück – nicht alle Frauen können das so empfinden. Warum? Das kann ganz verschiedene Ursachen haben und liegt nicht sofort daran, dass mit den Frauen, die das nicht empfinden, etwas nicht stimmt. Schon die Schwangerschaft, aber dann auch die Geburt – egal, wie entbunden wurde – sind oft etwas enorm Anstrengendes, sowohl für Körper als auch Psyche der Entbindenden. Ein Wochenbett mit sechs Wochen strenger Bettruhe und viel Unterstützung durch das familiäre Umfeld, wie es früher üblich war, gibt es heute meistens nicht mehr. Im Idealfall hat der Vater des Kindes noch frei und kann helfen, aber auch das ist ja nicht immer so. Dann kommt bei vielen Erstgebärenden eine Überforderung durch die völlig neuen Lebensumstände hinzu – die Geburt des ersten Kindes ist ein sehr einschneidendes Lebensereignis und fast nichts bleibt im bisher gewohnten Alltagsablauf gleich. Mit einem oder mehreren Kindern in jüngeren Lebensjahren muss man oft zumindest in den ersten Wochen und Monaten auf einen geregelten Schlaf, auf Zeit für sich und auf gewohnte Abläufe verzichten. Das tut man insofern natürlich gerne, weil man seine Kinder liebt, aber es wäre eine Lüge, dass es deshalb nicht auch gleichzeitig oft anstrengend und enorm auslaugend und kräftezehrend wäre. Gleichzeitig haben viele Frauen eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst in ihrer Mutterrolle. Perfektionismus und von Werbung und Medien genährte überhöhte Ansprüche an die eigenen mütterlichen Fähigkeiten können einen enormen psychischen Druck erzeugen, unter dem manche Mütter stehen. Es wird oft auch gesellschaftlich und vom Umfeld suggeriert, dass eine gute Mutter allzeit für ihr Baby da ist, immer sofort weiß, was das Kind braucht und sich ausschließlich mit dem kindlichen Wohlergehen befasst. Wie entsteht eine Wochenbettdepression? Durch Schwangerschaft und Geburt ist die Konstellation der weiblichen Geschlechtshormone ganz anders als sonst. Wir wissen ja, dass es auch unabhängig von Schwangerschaft und Geburt hormonelle Einflüsse auf unsere Stimmung gibt. Viele Frauen kennen das zum Beispiel auch in den „Tagen vor den Tagen“ (prämenstruelles Syndrom). Durch die speziellen, sehr starken Hormonausschüttungen in der Schwangerschaft, bei der Geburt und danach kann die Stimmung extrem beeinflusst werden – auch in die depressive Richtung. Oft beginnen Depressionen im Zusammenhang mit einer Geburt auch nicht erst im Wochenbett, sondern schon im Verlauf der Schwangerschaft. Fachleute reden daher allgemeiner häufig von „peripartaler“ Depression, also Depression um die Geburt herum. Wenn dann noch andere Faktoren, die eine Depression begünstigen, dazu kommen, kann die Stimmung schnell kippen. Wie äußert sich eine Wochenbettdepression? Die Symptome sind bei einer Wochenbettdepression die gleichen wie auch bei jeder anderen depressiven Störung: Die Betroffenen leiden unter einer dauerhaften gedrückten Stimmung und anhaltenden Niedergeschlagenheit. Viele fühlen sich erschöpft und kraftlos im Alltag, man hat oft für eigentlich gewöhnliche und routinierte Tätigkeiten kaum Antrieb, auch das Zähneputzen kann bei schweren Depressionen schon eine immense Herausforderung sein. Viele können kaum mehr Freude oder andere positive Gefühle empfinden, manche berichten auch von einer inneren Leere oder einem „Gefühl der Gefühllosigkeit“. Oft bestehen darüber hinaus negative und pessimistische Denkinhalte vor allem bezüglich der eigenen Zukunft mit entsprechender Hoffnungslosigkeit, man kann gar nicht mehr glauben, dass es jemals besser werden kann und resigniert zunehmend, weil sich alles einfach so unfassbar schwer anfühlt. Durch die Depression kommt es auch häufig zu Schlafstörungen und verändertem Appetit (meistens Appetitmangel, manchmal auch Frustessen und Heißhungerattacken). Es bestehen oft Schuldgefühle und ein Gefühl der Wertlosigkeit. Viele Frauen ereilt kurz nach der Geburt der so genannte „Babyblues“. Was ist das? Es gibt hier – wie bei allen Depressionen – meist fließende Übergänge. Oft ist der „Babyblues“ eine Vorstufe mit noch schwächeren, aber sehr ähnlichen Symptomen, die recht bald einige Tage nach der Geburt auftreten und ein paar Tage lang anhalten. Das kommt recht häufig vor, es werden Häufigkeiten von 50-80% beschrieben. Ein Babyblues verschwindet dann aber eben bei vielen Frauen auch nach wenigen Tagen wieder. Wenn die Symptome aber weiter anhalten – mindestens zwei Wochen – und sich vielleicht auch noch verstärken, kann sich auch eine Wochenbettdepression daraus entwickeln. Was kann helfen? Schon vor der Geburt eines Kindes sollte man realistisch die eigenen Erwartungen und Bedingungen prüfen. Keine Frau kann wirklich alleine rund um die Uhr ihr Kind über längere Zeit versorgen. Sich aktiv Hilfe zu suchen und anzunehmen, ist kein Zeichen von Schwäche oder mangelnder Eignung als Mutter oder gar fehlender Mutterliebe, sondern ist wertvoll und wichtig, um die Kräfte längerfristig zu erhalten. Ein gutes soziales Netz ist sehr hilfreich, das sprichwörtliche „Dorf“, um ein Kind gut großzuziehen. Es kann sehr entlasten, wenn jeden Tag der Opa mit seinem neuen Enkelkind eine Runde spazieren geht und sich die Mutter in der Zeit einfach mal um sich kümmern kann. Wenn die Oma oder Tante das Kochen übernimmt und der Partner die Einkäufe macht. Ehrliche Gespräche mit anderen Müttern über die Belastungen in den ersten Wochen mit dem Kind können einfach gut tun und zeigen: Ich bin nicht alleine, auch andere sind überfordert und fühlen sich ausgelaugt. Das kann der Entwicklung von Schuld- und Versagensgefühlen entgegenwirken. Was kann speziell der Partner tun? Miteinander reden und aktiv erfragen, wie man konkret helfen kann und auch ohne explizite Aufforderung selbst von Anfang an aktiv bei der Versorgung des Kindes mitmachen. Bis aufs Stillen kann jede Aufgabe der Säuglingsversorgung auch von anderen als der Mutter übernommen werden – das darf man auch aktiv nutzen. Hier ist es natürlich von Vorteil, wenn die Partner aktiven Gebrauch von der Möglichkeit von Elternzeit insbesondere in den Wochen nach der Geburt machen und möglichst viel zuhause präsent sein können. Wann sollte man Hilfe holen? Wenn mehrere Symptome einer Depression erfüllt sind und schon länger als zwei Wochen anhalten, sollte man auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen. Gute Ansprechpartnerinnen sind die nachbetreuende Hebamme oder die Frauenärztin. Es gibt auch Beratungsstellen, in Bayreuth beispielsweise bei der Diakonie. In schweren Fällen kann eine stationäre Behandlung erforderlich sein, oft kann man aber schon viel ambulant tun.