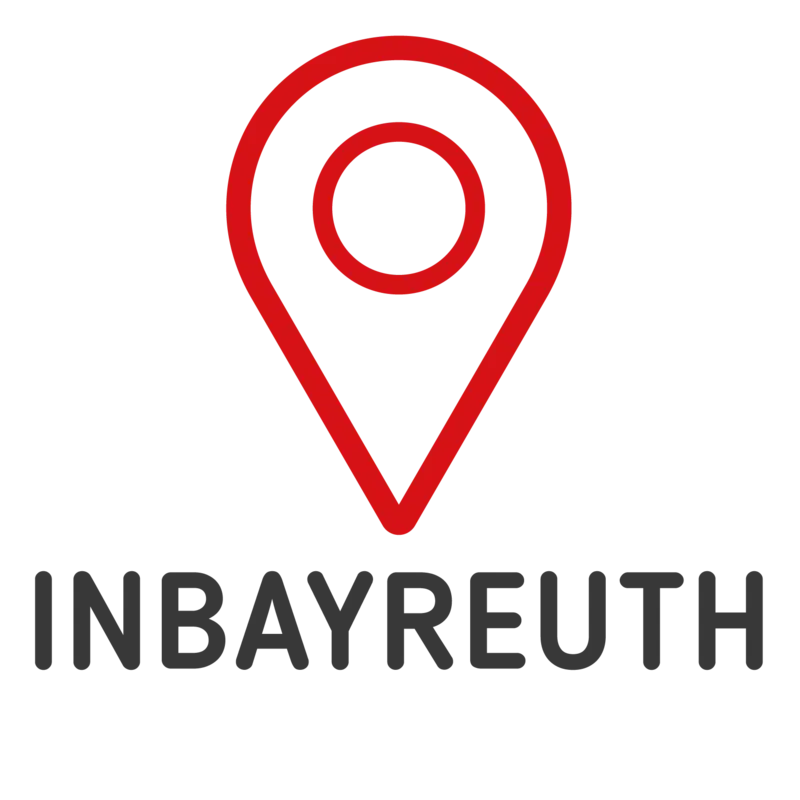Bayreuth: Trotz Hitze genügend Löschwasser für die Feuerwehr?
BAYREUTH. Dienstag, 15. August, 20.30 Uhr: Im Gebäude des Restaurants Sudpfanne im Bayreuther Stadtteil Oberkonnersreuth bricht ein Feuer aus. Stundenlang sind Feuerwehrleute im Einsatz, um den Dachstuhlbrand zu bekämpfen, während die Bayreuther Bevölkerung gewarnt wird, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten. Es kommen keine Menschen zu Schaden, doch große Teile des Gebäudes werden von den Flammen zerstört. Teile des Restaurants und Privaträume im Obergeschoss sind unwiederbringlich verloren.
Doch stellt die Brandbekämpfung im Hochsommer eine besondere Herausforderung dar, wenn Niederschläge selten und Löschwasserreserven womöglich kostbarer als gewöhnlich sind? Die Bayreuther Sonntagszeitung hat mit Stadtbrandrat Ralph Herrmann und Kreisbrandmeisterin Stephanie Bleuse von den Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Bayreuth gesprochen.
Feuerwehr Bayreuth: Löschwasser im Sommer
Maximal 300 Meter. So groß ist laut dem Bayreuther Stadtbrandrat Ralph Herrmann in Bayreuth der Abstand Gebäuden bis zum nächsten Wasserhydranten. Die stellen immer die sogenannte „erste Leitung” für die Wasserverteilung dar. Im Ernstfall sind ein oder mehrere Hydranten schließlich dafür da, die Versorgung mit Löschwasser sicherzustellen.
„Da spielt keine Wasserknappheit keine Rolle”, verdeutlicht Bleuse im Hinblick auf ausbleibenden Regen. Der Sicherheit der eingesetzten Atemschutztrupps der Feuerwehr gilt dann ebenso Priorität wie „Menschen und Tiere, die wir retten, und Sachwerte, die wir erhalten wollen”, führt Bleuse weiter aus. Hier geht es zu den Bildern vom Morgen nach dem Brand der Sudpfanne.
Löschteiche können austrocknen
Erst wenn die Versorgung über eine „erste Leitung” sichergestellt ist, könne der Zugriff auf öffentliche Gewässer erfolgen - und die sind längst nicht so zuverlässig, wenn Regen tatsächlich mal länger ausbleibt. „Sinkende Fluss- und Bachpegel führen weniger Wasser, zu geringe Wassertiefen führen zu Mehraufwand, wenn wir vor der Wasserentnahme das Wasser anstauen müssen, um die notwendige Mindestwassertiefe zu erreichen, um mit unserer Technik überhaupot Wasser entnehmen zu können.”
Die Gleichung „kein Regen, kein Löschwasser” kann zumindest dort aufgehen, wo Reserven ohnehin überschaubar sind. „Löschteiche können mit ihrem Wasserstand soweit zurückgehen, dass sie gänzlich austrocknen. Sie werden ausschließlich durch Niederschläge gespeist.
Feuerlöschen im Sommer körperliche Schwerstarbeit
Bei Bränden in schwer zugänglichen Gebieten oder abseits von Hydranten nennen Herrmann und Bleuse Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr als gängige Methode der Brandbekämpfung.
Bei besonders großer Trockenheit kommen im ersten Zug besonders viele Kameraden zum Einsatz. Von denen wird „körperliche Schwerstarbeit abverlangt”, betont Bleuse. Ein Wechsel mit anderen Feuerwehrleuten erfolgt besonders häufig. Die sogenannte „Marscherleichterung”, also die Entscheidung, ob die Feuerwehrleute einen Teil ihrer schweren und warmen Schutzausrüstung ablegen dürfen, fällt der Einsatzleiter je nach den Gegebenheiten beim Einsatz vor Ort.